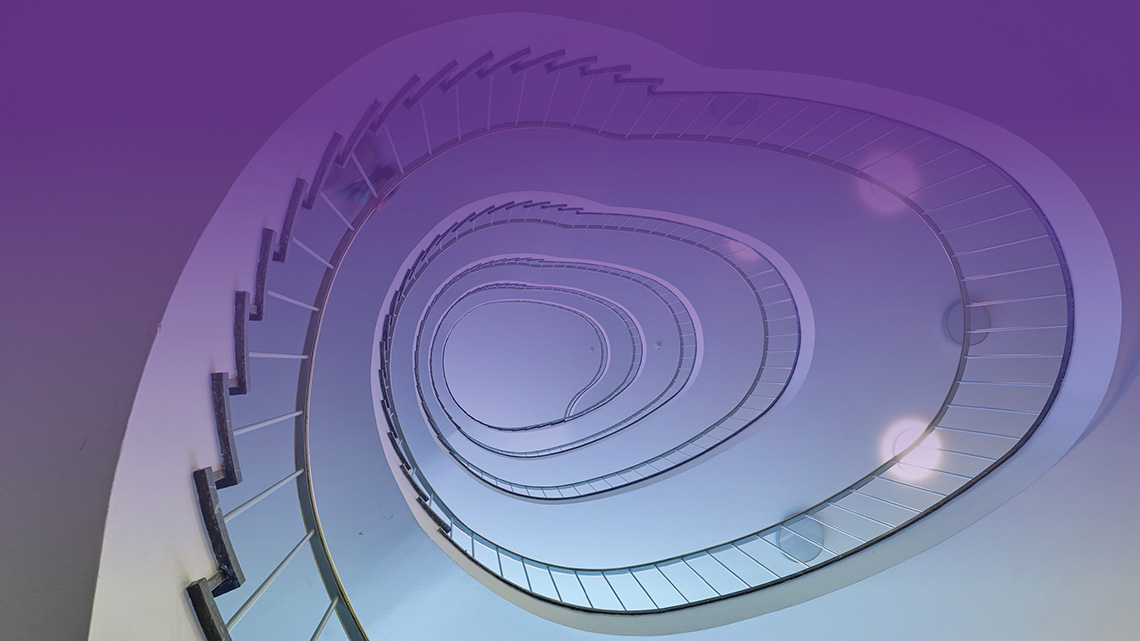
In einer neuen Ausgabe der Publikationsreihe „Im Fokus“ beleuchten die Fachleute der VDI/VDE-IT die deutsche Gründungsszene und zeigen sieben zentrale Handlungsfelder auf, um mehr Förderchancen für dynamisch wachsende, junge Unternehmen zu schaffen.
Vom Start-up zum Scale-up
Denn besonders schnell wachsende junge Unternehmen – sogenannte Scale-ups – sind wichtige Treiber für Innovation, Wachstum und wirtschaftliche Dynamik. Scale-ups zeichnen sich typischerweise durch ein über drei Jahre hinweg betrachtetes signifikantes Beschäftigten- und/oder Umsatzwachstum von 20 Prozent und mehr auf Basis eines profitablen und skalierbaren Geschäftsmodell aus. Sie verfügen in der Regel über eine starke technologische Expertise, industrielle Einbindung und wachsende internationale Präsenz. Und sie besitzen ausgeprägte Übertragungseffekte, sogenannte „Spillovers“, auf ihre und angrenzende Märkte, Wirtschaftszweige und Innovationsökosysteme.
Aktuell lassen sich im Jahr 2025 in Deutschland 975 Scale-ups mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro zählen. Gemessen an den rund 21.183 in Deutschland aktiven Start-ups anteilig recht klein, generieren sie aber einen Großteil der Umsätze und überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze. Der erfreulich hohe und wachsende Start-up-Bestand Deutschlands lässt zudem ein größeres Potenzial an Scale-ups erwarten. Die EU-Kommission schätzt dies im europaweiten Blick ähnlich ein.
Wie man das eigene Innovationsökosystem stärkt
Scale-ups fördern ist insofern ein zentrales Leitmotiv, will man die Innovationsökosysteme weiter stärken. Hier muss man sich mit zentralen strukturellen Herausforderungen auseinandersetzen. Neben dem Zugang zu Kapital sind es insbesondere auch geeignete Rahmenbedingungen, Skalierungsunterstützung, Vernetzung, gezielte Innovationsförderung bzw. besser: -beschaffung sowie organisatorische Entwicklung, die über das reine Finanzierungsangebot hinaus für nachhaltiges Wachstum entscheidend sind.
Gleichzeitig fehlt es an Kapital. Hinzu kommen Fachkräfteknappheit, beschränkte Ökosystemfunktionalitäten sowie mehr auf Scale-ups zugeschnittene Förderung, einschließlich entsprechender Monitoring- mithin Politikberatungs- und Steuerungsgrundlagen. Überdies fehlt es an einer einheitlichen – zumindest europäischen – Definition von Scale-ups.
Das Autorenteam greift in der vorliegenden Veröffentlichung aus der aktuellen Debatte und der einschlägigen Forschung (erste) stärker auffindbare Handlungserfordernisse detaillierter auf.

