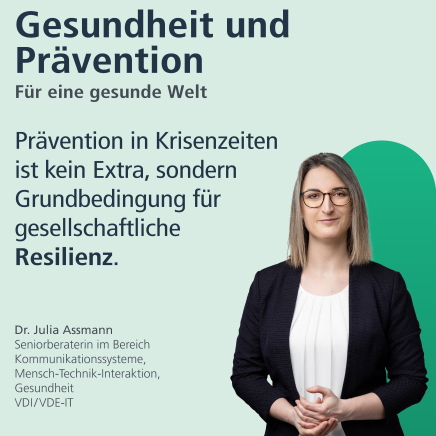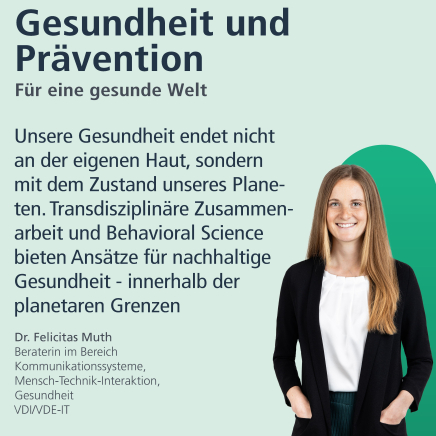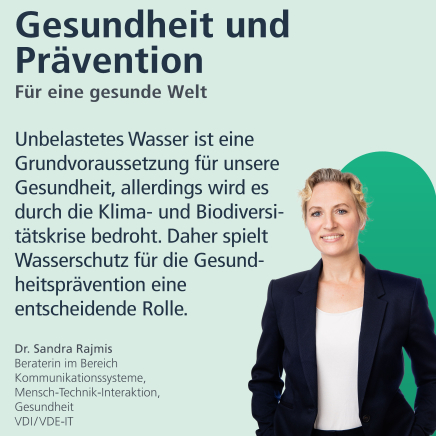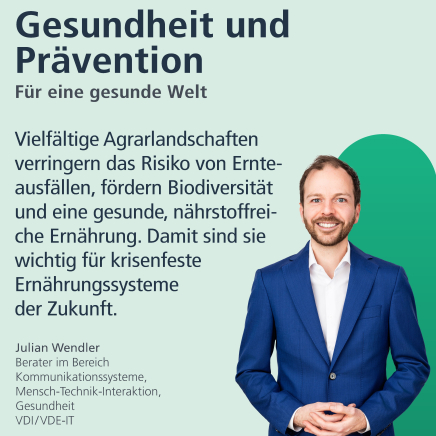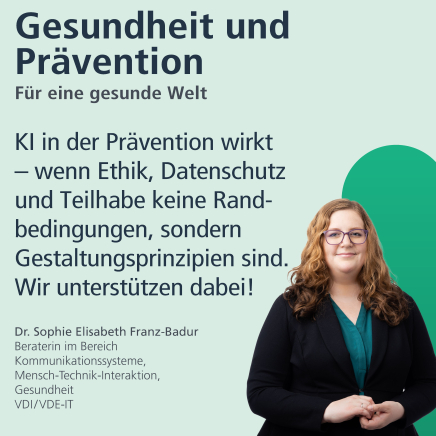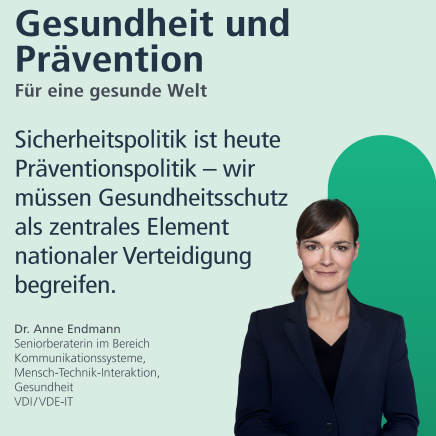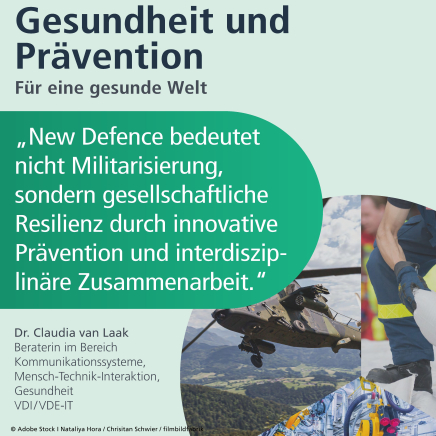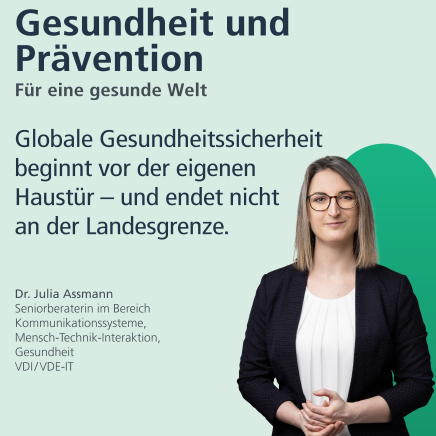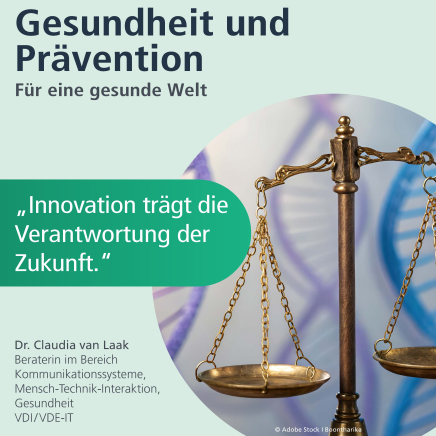„There is no glory in prevention“ wurde mit der Covid-19 Pandemie zum geflügelten Wort. Wir finden, Prävention hat mindestens unsere Aufmerksamkeit verdient und befassen uns deshalb in diesem Dossier mit der interdisziplinären Aufgabe, die Gesundheit des Menschen und des Planeten zu schützen. In den folgenden Beiträgen findet sich die Expertise unserer Mitarbeitenden des Bereichs Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit, die einige Aspekte moderner Präventionsarbeit für uns beleuchten.
Ausgewählte Beiträge unserer Expert:innen
- Prävention in Krisenzeiten - Warum ist Prävention so wichtig?
Prävention in Krisenzeiten bedeutet mehr als Vorsorgeuntersuchungen und Verhaltenstipps: Sie verlangt ein neues, erweitertes Verständnis davon, was es heißt, Gesundheit zu schützen – vorausschauend, vernetzt und resilient.
Klassische Verhaltensprävention zielt auf das Individuum: Viel Bewegung, ausgewogene Ernährung, umfassender Impfschutz. Doch in komplexen Krisensituationen reicht dieser Ansatz nicht aus. Was nützt eine gesunde Lebensweise, wenn Krankenhäuser überlastet, Antibiotika knapp oder Wasserquellen verschmutzt sind?
Prävention heute muss mehr können – und sie muss systemisch gedacht werden. Die sogenannte Verhältnisprävention muss dafür verstärkt werden. Sie nimmt unter anderem folgenden Fragen in den Blick:
- Wie stärken wir Versorgungssicherheit (Wasser, Nahrung, medizinische Versorgung, etc.) und Früherkennung? (Siehe auch der untenstehende Beitrag zu One Health)
- Wie gestalten wir unseren Planeten klimaresilient und gesundheitserhaltend? (Siehe auch die untenstehenden Beiträge zu Planetary Health)
- Wie verhindern wir, dass Forschung ungewollt zur Sicherheitsgefahr wird? (Siehe auch der untenstehende Beitrag zu Dual Use)
Krisen zeigen uns, wo bestehende Präventionsansätze zu kurz greifen – und warum es einen Schulterschluss zwischen Gesundheitspolitik, Forschung, Sicherheit und Umwelt braucht. Genau hier setz die Verhältnisprävention an.
Aber: Die Effekte von Prävention – vor allem struktureller – zeigen sich nicht immer sofort. Anders als ein Medikament, das kurzfristig lindert, braucht Prävention Zeit, Verlässlichkeit und wissenschaftliche Begleitung, um ihre Wirkung voll zu entfalten. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Maßnahmen kontinuierlich erforscht, evaluiert und angepasst werden, um ihre Wirkung auf die öffentliche Gesundheit langfristig sichtbar und wirksam zu machen.
Dr. Julia Assmann ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
- Resilienz im Gesundheitswesen – Stärken & Schwächen im Krisenfall
Ein resilientes Gesundheitssystem beginnt nicht mit dem Notfallplan – sondern mit der Fähigkeit, Krisen früh zu erkennen, auf sie zu reagieren und ihnen systematisch vorzubeugen. Pandemien, extreme Wetterlagen, Lieferengpässe, Fachkräftemangel und anhaltende internationale Konflikte und Spannungen – die Herausforderungen für unser Gesundheitswesen sind vielfältig. Und sie werden nicht weniger. Resilienz ist zum Schlüsselbegriff geworden. Doch was genau macht ein Gesundheitssystem eigentlich krisenfest?
Krisen wie die Covid-19-Pandemie oder die jüngste Hitzewelle in Europa führen uns die Schwächen im Gesundheitsapparat eindringlich vor Augen – lassen uns aber auch die Hebel entdecken, mit denen die nächste Krise besser bewältigbar wird:
Prävention ist in vielen Fällen wirtschaftlich effizienter als Nachsorge. Sie schützt nicht nur Leben, sondern auch Gesundheitsbudgets, Sozialsysteme und Infrastruktur. Für die Einzelperson bedeutet das: Weniger Krankheitslast, höhere Lebensqualität und weniger Abhängigkeit von akuten Interventionen.
Deshalb lohnt es sich, den Stellenwert von Prävention in der Versorgungs- und Forschungspolitik deutlich zu stärken – nicht erst im Ernstfall, sondern als strategisches Grundprinzip.
Als Projektträger unterstützen wir Politik und Gesundheitssystem dabei, durch Prävention Leben zu schützen, unter anderem durch:
- frühzeitige Risikoidentifikation (z. B. durch Trendanalysen, Szenarien, Monitoring),
- Beratung von Politik und Fördergebern zu wirkungsvollen Präventionsansätzen,
- Entwicklung und Umsetzung von Programmen, die strukturelle Resilienz ermöglichen – z. B. durch Digitalisierung im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Forschung zur Krisenreaktion oder intersektorale, bereichsübergreifende Kooperationen.
Unsere Aufgabe: Komplexität managen, Wissen bündeln und gemeinsam mit Wissenschaft, Verwaltung und Praxis dafür sorgen, dass Resilienz nicht nur ein Schlagwort bleibt.
Dr. Julia Assmann ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Andrea Sieberg ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.- One Health & Zoonosen – Warum Prävention global und intersektoral, bereichsübergreifend gedacht werden muss
Mehr als 60 % aller neu auftretenden Infektionskrankheiten beim Menschen haben einen tierischen Ursprung – sogenannte Zoonosen. Ob SARS-CoV-2, Ebola oder Vogelgrippe: Die nächste Pandemie entsteht vielleicht nicht im Krankenhaus, sondern im Stall, im Regenwald oder entlang globaler Lieferketten. Durch Warenströme, Handel, Transport und Produktionsverlagerung birgt die globalisierte Welt ein strukturelles Risiko, das neue Zoonosen entstehen.
Was bedeutet das für die Prävention? Gesundheitsschutz darf nicht erst beim Menschen beginnen, sondern muss viel früher ansetzen: an den Schnittstellen von Tierhaltung, Biodiversität, Umwelt und Handel. Der sektorübergreifende Ansatz One Health bietet dafür den geeigneten Rahmen: Menschliche, tierische und ökologische Gesundheit werden hier zusammengedacht - und es wird gezielt dort interveniert, wo neue Risiken entstehen.
One Health bedeutet auch, Prävention nicht nur als Aufgabe der Gesundheitsversorgung, sondern auch als politisches Handlungsfeld zu verstehen: Zoonosen sind kein rein medizinisches Problem. Sie sind eine Folge systemischer Wechselwirkungen. Prävention funktioniert nur, wenn Gesundheits-, Agrar-, Umwelt- und Forschungspolitik gemeinsam handeln – national wie international.
One Health verspricht:
- Reduktion zukünftiger Krankheitslast
- Vermeidung wirtschaftlicher Folgekosten
- Stärkung globaler Resilienz
Internationale Organisationen wie die WHO, HERA oder FAO setzen längst auf One Health. Jetzt gilt es, auch auf nationaler Ebene institutionelle Voraussetzungen und Fördermechanismen zu schaffen, die sektorübergreifendes Handeln ermöglichen.
Dr. Julia Assmann ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
- One Health: Antibiotikaresistenzen – Eine stille Krise, die interdisziplinäre Antworten braucht!
Antibiotikaresistenzen zählen laut WHO zu den größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. Die sogenannte „post-antibiotische Ära“, in der selbst harmlose Infektionen lebensgefährlich werden können, ist keine entfernte Zukunft – sie ist in Teilen bereits Realität: neue Daten des Robert Koch-Instituts und des Institute for Health Metrics and Evaluation (USA) zu Todesfällen durch antibiotikaresistente Erreger in Deutschland zeigen, dass im Jahr 2019 ca. 9.600 Menschen unmittelbar aufgrund der Resistenz des Erregers gestorben sind.
Die Ursachen für Antibiotikaresistenzen sind komplex – und sie liegen nicht nur im menschlichen Antibiotikaverbrauch, sondern auch:
- in der Nutztierhaltung
- in Umwelt- und Abwassereinträgen
- in internationalen Lieferketten und Reiseströmen
- im unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika
One Health zeigt: Nur durch sektorübergreifende Kooperation können Resistenzen wirksam eingedämmt werden. Einzelmaßnahmen reichen nicht. Was es braucht, ist eine interdisziplinäre Präventionsstrategie, die Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Umweltpolitik und Innovation gemeinsam denkt, um Antibiotikaresistenzen zu vermeiden.
Nur ein sektorübergreifender Präventionsansatz kann langfristig Wirkung entfalten. Denn Antibiotikaresistenzen entstehen an den Schnittstellen – zwischen Humanmedizin, Veterinärwesen, Landwirtschaft, Umwelt und globalem Handel.
Internationale Initiativen wie CARB-X und GARDP zeigen, wie solche Kooperationen konkret aussehen können:
- CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) fördert weltweit frühe Entwicklungsstadien neuer Antibiotika, Diagnostika und Impfstoffe – mit Partnern aus Wissenschaft, Industrie und öffentlicher Hand.
- GARDP (Global Antibiotic Research & Development Partnership) entwickelt gezielt neue, bezahlbare Antibiotika für unterversorgte Bevölkerungsgruppen – gemeinsam mit Staaten, WHO, Forschungsinstituten und NGOs.
Solche Plattformen sind mehr als nur Forschungsförderung: Sie sind strategische Knotenpunkte, an denen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft gemeinsame Verantwortung übernehmen – und globale Public Health-Ziele in konkrete Projekte übersetzen.
Was bedeutet das für Politik, Forschung und Förderpraxis?
Eine konsequente Förderung neuer antimikrobieller Wirkstoffe, Frühwarnsysteme und Datenaustausch über Sektorgrenzen hinweg und klare Governance-Strukturen auch in der internationalen Zusammenarbeit.
Dr. Andrea Sieberg ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
- Planetary Health – Gesundheit neu denken
-
Was haben Extremwetter, chronischen Erkrankungen und Ernährungsunsicherheit gemeinsam? Nur auf einem gesunden Planeten kann es auch gesunde Menschen geben: Das ist die Grundannahme im Konzept Planetary Health.
Planetary Health beschreibt die enge Verbindung menschlicher und planetarer Gesundheit. Unser Verhalten beeinflusst Klima und Biodiversität – und damit unsere körperliche wie psychische Gesundheit. Diese Zusammenhänge sind längst spürbar: Nicht-übertragbare Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen durch Luftverschmutzung, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung zu. Klimabedingte Veränderungen führen zu Migration – mit weitreichenden gesundheitlichen und sozialen Folgen.
Unsere Expert:innen arbeiten daran, nachhaltige Lösungen im Rahmen von #PlanetaryHealth voranzubringen, unter anderem in diesen Bereichen:
Ernährungssysteme der Zukunft
Um Ernährung langfristig zu sichern, braucht es Kulturpflanzen, die an Klima, Krankheiten und Schädlinge angepasst sind. Alte Sorten mit wertvollen Eigenschaften drohen verloren zu gehen, wenn sie nicht erhalten werden. Wir verfügen über Expertise in Strategien zur Konservierung agrargenetischer Vielfalt – eine Aufgabe, die der Global Crop Diversity Trust maßgeblich vorantreibt. Neue Technologien wie CRISPR-Cas ermöglichen zudem gezieltere Züchtung.Gewässerökologie & Gesundheit
Immer häufiger werden Strände wegen Blaualgen gesperrt, deren Gifte die Gesundheit beeinträchtigen können. Mit unserer Expertise haben wir das Projekt DIVATOX begleitet, das untersucht, wie Umweltbedingungen und Wasserpflanzen das Auftreten giftiger Blaualgen beeinflussen – um Risiken frühzeitig zu erkennen.Agrarökologie
Vielfältige Anbausysteme stärken Biodiversität und Bodengesundheit – und können die Qualität von Lebensmitteln verbessern. Das von uns betreute Projekt DCropS4OneHealth erforscht Einflüsse von Anbausystemen auf Bodenleben, Pflanzen und Insekten sowie deren Effekte auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe.Planetary Health ist kein Randthema, sondern ein Kompass für zukunftsfähiges Handeln über Disziplinen hinweg.
Dr. Felicitas Muth ist Beraterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Sandra Rajmis ist Beraterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Felix Frey ist Berater im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Julian Wendler ist Berater im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit. - Pandemieprävention braucht Partnerschaft – Public Private Partnerships als strategisches Sicherheitsinstrument
Kein Land und kein Unternehmen ist dazu in der Lage, Pandemien alleine zu verhindern. Moderne Prävention setzt daher auf Public Private Partnerships (PPPs): Kooperationen zwischen staatlichen Institutionen und privaten Unternehmen, bei denen beide Seiten gemeinsam öffentliche Aufgaben erfüllen.
Die Ebola-Epidemie 2014/15 und die COVID-19-Pandemie haben deutlich gemacht: Die Entwicklung von Impfstoffen, Diagnostika und Therapien erfordert nicht nur Tempo und innovative Technologien, sondern auch stabile internationale Strukturen und kooperative Finanzierungsmodelle. Ohne sie verzögert sich der Zugang zu Heil- und Vorsorgemitteln oder bleibt dem globalen Norden vorbehalten.
PPPs wie CEPI, GARDP oder CARB-X sind entscheidende Innovationsplattformen, um globalen Antworten auf globale Krisen zu finden:
- CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) unterstützt frühzeitig die Entwicklung von Impfstoffen, beispielsweise gegen SARS-CoV-2.
- GARDP (Global Antibiotic Research & Development Partnership) verfolgt die globale Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen.
- CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) fördert gezielt neue antibakterielle Wirkstoffe im Frühstadium.
Diese PPPs bündeln öffentliche Mittel, wissenschaftliche Exzellenz und unternehmerisches Know-how, um globale Gesundheitsrisiken schneller, gezielter und gerechter zu adressieren. Sie reagieren dabei auch auf strukturelles Marktversagen: Denn Investitionen in Impfstoffe, Antibiotika oder Diagnostika gegen seltene oder potenziell pandemische Erreger lohnen sich oft nicht im klassischen Geschäftsmodell von Pharmaunternehmen.
Gerade im Sinne von One Health schaffen PPPs hier neue Anreize und verknüpfen Human-, Tier- und Umweltgesundheit mit nachhaltiger Innovationsförderung. Deutschland beteiligt sich an mehreren Initiativen – unter anderem über das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie das Auswärtige Amt. Doch finanzielle Beiträge allein genügen nicht:
Auch strategische Verzahnung mit nationalen Förderlogiken, bessere Integration in deutsche Forschungs- und Innovationspolitik und eine klare Governance für internationale Partnerschaften sind notwendig, um künftigen Pandemien gemeinschaftlich zu begegnen.
Hier kommen wir ins Spiel: Wir begleiten politische Entscheidungsträger:innen, bieten Analysen internationaler Förderlandschaften, unterstützen die Vernetzung und beraten zu Partnerschaften.
Pandemieprävention ist ein globales Gemeinschaftsprojekt. Wir sorgen dafür, dass Politik, Wissenschaft, Unternehmen und NGOs Hand in Hand für Sicherheit und Gesundheit einstehen.
Dr. Birte Kretschmer ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
- Impfstoffentwicklung, Vertrauen und Vorsorge – Was zwischen Pandemien zählt.
Impfstoffforschung braucht nicht nur innovative Technologien, sondern vorausschauende Investitionen und gesellschaftliches Vertrauen, auch in krisenarmen Zeiten. Denn wenn Impfstoffe dringend gebraucht werden, ist es oft schon zu spät, sie zu entwickeln. Pandemievorsorge darf daher nicht erst im Ernstfall einsetzen, sondern muss in den Jahren zwischen Gesundheitskrisen erfolgen.
Die COVID-19-Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen Forschung, Industrie und Politik ist: mRNA-Technologien, globale Produktionsnetzwerke und beschleunigte Zulassungsverfahren haben Impfstoffe in Rekordzeit ermöglicht und somit die Dynamik der Pandemie entscheidend beeinflusst – medizinisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich.
Aber diese Erfolge waren kein Zufall. Sie basierten auf jahrzehntelanger Forschung, strategischen Investitionen und Public Private Partnerships wie CEPI, welche die Entwicklung von Impfstoffen und Plattformtechnologien auch in pandemiefreien Zeiten fördern. Pandemievorsorge bedeutet genau das: heute investieren, um morgen handlungsfähig zu sein!
Warum das allein nicht reicht? Weil Vertrauen nicht aus dem Labor kommt. Die Akzeptanz von Impfungen hängt auch von Wissenschaftskommunikation, transparenten Zulassungsverfahren und gesellschaftlicher Teilhabe ab. Gerade in einer Zeit, in der gezielte Desinformation zunimmt, muss Vertrauen durch offene Kommunikation geschaffen werden.
Dr. Martin Voß ist Berater im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
- Wie der öffentliche Gesundheitsdienst zum Treiber moderner Prävention wird
Die Corona-Pandemie hat Schwächen in Katastrophenvorsorge und Verwaltung offengelegt – zugleich sind hierdurch umfangreiche Aktivitäten entstanden, um besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Gesundheitsämter und der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD).
Ihre Nähe zur Bevölkerung macht Gesundheitsämter unverzichtbar: Schuleingangsuntersuchungen, Impfungen, amtsärztliche Untersuchungen, Infektionsschutz, Wasserhygiene – der ÖGD ist vor Ort, reagiert frühzeitig und wirkt präventiv. Als Dreh- und Angelpunkt für die Gesundheit der Bevölkerung erfüllen Gesundheitsämter wichtige Monitoring-, Melde- und Aufsichtsaufgaben. Die Daten, die bei Ihnen gemeldet werden, fließen in die Gesundheitsberichterstattung ein und schaffen die Grundlage für evidenzbasiertes Handeln.
Darüber hinaus ist der ÖGD auch ein zentraler Akteur in der Prävention und Gesundheitsförderung. Im Rahmen integrierter kommunaler Strategien und in enger Zusammenarbeit mit anderen relevanten Akteuren – etwa aus Bildung, Sozialwesen oder Stadtentwicklung – werden gesundheitsförderliche Prozesse initiiert, koordiniert und nachhaltig begleitet.
Für effektiven Gesundheitsschutz braucht es jedoch nicht nur qualifiziertes Personal, sondern auch moderne digitale Strukturen.
Der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst greift diese Bedarfe auf. Mit 4 Mrd. Euro sollen Strukturen gestärkt, Personalaufbau gefördert und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Ziel ist es, Prozesse zu vereinfachen, medienbruchfreie Datenübertragungen zu ermöglichen und schnelle Analysen für effektive Maßnahmen zu schaffen. Dies befähigt die Einrichtungen des ÖGD auch in Krisenzeiten zu einem schnellen und effizienten Handeln. Gleichzeitig fördert der Pakt die Zusammenarbeit auf kommunaler und Landesebene. So können bundeslandspezifische Besonderheiten berücksichtigt und abgestimmte Lösungen entwickelt werden.Hannah van Eickels ist Beraterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Eva Suhren ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.- Künstliche Intelligenz in der Gesundheitsprävention: Zwischen Aufbruch und Verantwortung
„Wer viel misst, misst viel Mist!“ – das galt lange Zeit auch im Gesundheitsbereich: Daten ohne Kontext führten oft zu Verwirrung statt zu Vorsorge. Doch mit KI ändert sich das Spiel.
KI kann das Wesentliche vom Zufälligen trennen, Muster im Datenchaos erkennen und nicht nur mehr, sondern vor allem bessere Informationen liefern. Aus ‚viel Mist‘ wird so plötzlich sinnvolle Medizin – evidenzbasiert, individuell und präventiv. Dadurch eröffnen sich neue Chancen, Prävention intelligenter und persönlicher zu gestalten.
Prävention ist deshalb so entscheidend, weil sie Krankheiten gar nicht erst entstehen lässt, anstatt sie nur zu behandeln – und mit Hilfe intelligenter, kontextsensitiver Analysen wird sie gezielter, wirksamer und bedarfsorientierter.
Schon heute unterstützen KI-Lösungen die präventive Gesundheitsversorgung:
- prädiktive Frühwarnsysteme für zum Beispiel Demenz und chronische Erkrankungen
- smarte Wearables zur Verhaltensunterstützung
- Chatbots für niederschwellige Präventionsberatung
- personalisierte Risikoanalysen basierend auf genetischen Daten
Das Ziel? Krankheiten früher erkennen, gezielter vorbeugen, Versorgungslücken schließen. Die Chancen sind enorm – für Individuen wie für die Gesellschaft. Aber: Fortschritt braucht Richtung. Denn dort, wo KI wirkt, stehen auch Fragen im Raum: Wie sichern wir Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung? Wie verhindern wir algorithmische Verzerrungen und Diskriminierung? Wie gestalten wir digitale Teilhabe inklusiv – auch für vulnerable Gruppen?
Technologische Exzellenz allein reicht nicht. Es braucht politische Leitplanken, interdisziplinäre Forschung, gesellschaftliche Beteiligung – und klare Verantwortlichkeiten.
Dr. Claudia van Laak ist Beraterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Anne Dwertmann ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Sophie Elisabeth Franz-Badur ist Beraterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.- New Defence: Gesundheitsschutz als strategische Zukunftsaufgabe
-
Die COVID-19-Pandemie hat es uns unmissverständlich vor Augen geführt: Gesundheit ist keine rein medizinische, sondern auch eine sicherheitspolitische Schlüsselressource. „New Defence“ steht für ein erweitertes Verständnis von Verteidigung, das Prävention, gesundheitliche Resilienz und technologische Innovation vereint.
Was bedeutet „New Defence“ im Gesundheitskontext? New Defence steht für einen Paradigmenwechsel: Gesundheitliche Resilienz wird als integraler Bestandteil nationaler und globaler Sicherheitsstrategien betrachtet. Dabei werden robuste Public-Health-Strukturen gefördert und innovative Technologien genutzt. Die Pandemie hat gezeigt, dass nationale Alleingänge an ihre Grenzen stoßen – gefragt sind sektorübergreifende Kooperation, strategische Vorausschau und internationale Zusammenarbeit.
Missverständnisse vermeiden: Keine Militarisierung, sondern gesellschaftliche Mobilisierung
„New Defence“ ist kein Ruf nach Militär im Gesundheitswesen. Vielmehr geht es um einen ganzheitlichen „Whole-of-Society“-Ansatz. Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft übernehmen gemeinsam Verantwortung. Militärische Ressourcen können punktuell unterstützen – etwa beim Schutz kritischer Infrastrukturen oder in der Logistik –, doch der Fokus liegt klar auf Prävention, Innovation und zivilgesellschaftlicher Beteiligung.Innovationsgetriebene Perspektiven: Von KI bis One Health
Innovative Technologien wie KI-gestützte Frühwarn- und Meldesysteme sowie genomische Überwachung von Krankheitserregern eröffnen neue Möglichkeiten für die Früherkennung und Eindämmung von Pandemien. Der „One Health“-Ansatz verbindet Human-, Tier- und Umweltgesundheit und fördert interdisziplinäre Kooperationen – entscheidend für die Prävention zukünftiger Krisen.Balance zwischen nationalen Interessen und globaler Verantwortung
Pandemien machen an Grenzen nicht halt. Nationale Sicherheitsinteressen müssen mit globaler Solidarität und gerechtem Zugang zu medizinischen Ressourcen in Einklang gebracht werden. „New Defence“ fordert eine neue Balance: robuste nationale Strukturen und internationale Kooperation als sich ergänzende Säulen nachhaltiger Sicherheit.„New Defence“ regt an, Gesundheitsschutz als gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu begreifen – und schon heute die Weichen für die Bewältigung der Krisen von morgen zu stellen.
Dr. Anne Endmann ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Claudia van Laak ist Beraterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Julia Assmann ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit. - Dual Use in der Gesundheitsforschung – Wenn Wissen zur Gefahr wird
Gesundheitsforschung muss nicht nur Menschen nützen, sondern auch vor Missbrauch geschützt werden – durch vorausschauende Strukturen, die gesetzliche, ethische und politische Rahmenbedingungen gewährleisten.
Forschung kann Leben retten – oder gefährden. Wie gehen wir als Gesellschaft damit, wenn sich Forschung als zweischneidiges Schwert entpuppt? Als Mittel zum Schutz und als Bedrohung gleichermaßen?
Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse für Zwecke genutzt werden, für die sie nicht vorgesehen waren, spricht man von Dual Use. Besonders die Lebenswissenschaften stehen im Spannungsfeld zwischen medizinischem Fortschritt und möglichem Missbrauch:
- 2018: Das Horsepox-Virus wurde erstmals vollständig synthetisch im Labor rekonstruiert – ein wissenschaftlicher Meilenstein mit brisanter Kehrseite. Die gleiche Methode könnte genutzt werden, um das längst ausgerottete Pockenvirus (Variola) zurückzubringen.
- 2018: Mithilfe von CRISPR-Cas veränderte ein chinesischer Forscher gezielt das Erbgut menschlicher Embryonen. Was als medizinischer Fortschritt gedacht war, überschritt ethische Grenzen und wirft fundamentale Fragen zur Verantwortung in der Genomforschung auf, beispielsweise die nach den Risiken einer Weitergabe der veränderten Gene an nachfolgende Generationen oder die Entstehung potenziell schädliche Nebeneffekte.
- 2022: Ein Forschungsteam demonstrierte, dass ein KI-Modell, ursprünglich darauf trainiert, potenziell therapeutische Moleküle zu identifizieren, mit nur geringfügigen Modifikationen in der Lage war, binnen weniger Stunden zehntausende hochtoxische Verbindungen zu generieren. Darunter auch strukturelle Varianten des Nervengifts VX, eines international geächteten chemischen Kampfstoffs.
Risiken entstehen nicht nur durch kriminelle Absicht – sondern auch durch fehlende Rahmenbedingungen, Unklarheit in Zuständigkeiten oder mangelnde ethische Sensibilisierung. Moderne Rahmenbedingungen können hier Abhilfe leisten, ohne dabei die Freiheit der Forschung einzuschränken: Sie können klare Zuständigkeiten schaffen, Risiken frühzeitig adressieren und ethische Reflexion zur Selbstverständlichkeit machen. So fördern sie verantwortungsvolle Forschung, ohne den wissenschaftlichen Fortschritt einzuschränken.
Nur wer Risiken systematisch mitdenkt, kann Innovationen verantwortungsvoll ermöglichen.
Dr. Claudia van Laak ist Beraterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Julia Assmann ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.- Dual Use neu denken – Forschung als strategische Ressource in einer unsicheren Welt
Dual Use ist nicht nur Risiko, sondern auch strategische Chance – wenn Forschung sicher, koordiniert und geopolitisch klug gefördert wird. In einer zunehmend instabilen Welt wird Gesundheitsforschung zur Sicherheitsressource. Kann Dual Use auch Sicherheit durch zivile Forschung schaffen?
Dual Use heißt: doppelte Relevanz der Forschung. Forschungsergebnisse, die primär für zivilen Nutzen entstehen, können im Krisenfall zur resilienten Krisenbewältigung, Abwehr oder Vorsorge beitragen. Ob bei Pandemien, Resistenzen, Bioterrorismus oder der Entwicklung medizinischer Abwehrstrategien – wissenschaftliche Expertise ist bereits heute Teil kritischer Infrastruktur.
Strategische Potenziale für Gesundheit und Sicherheit:
- Impfstoffplattformen wie mRNA, die sich blitzschnell auf neue Erreger einstellen lassen – entscheidend für Pandemieabwehr und nationale Sicherheit, insbesondere durch die aktuelle Chance international eine Vorreiterrolle einzunehmen.
- Künstliche Intelligenz und Bioinformatik, die gefährliche Erreger frühzeitig erkennen – wertvoll für das öffentliche Gesundheitswesen und die Verteidigung.
- Synthetische Biologie, die kritische Substanzen unabhängig und bedarfsgerecht produziert– stärkt die Versorgungssicherheit und Innovationskraft.
- Internationale Frühwarnsysteme, die Bedrohungen rechtzeitig melden – schützen die Bevölkerung und tragen zu globaler Stabilität bei.
Forschung mit doppeltem Nutzen schafft Chancen – und neue Risiken. Zwischen Sicherheitsinteressen und Wissenschaftsfreiheit braucht es eine neue Balance: nicht durch Abschottung wie pauschale Kooperationsverbote, Exportbeschränkungen oder Unsicherheiten bei sensiblen Themen. Sondern durch vorausschauende Forschungssteuerung: mit klaren Regeln, nachvollziehbarer Risikoabwägung und verlässlicher Unterstützung für Forschende. So bleibt internationale Zusammenarbeit möglich – verantwortungsvoll und sicher.
Dr. Claudia van Laak ist Beraterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Dr. Julia Assmann ist Seniorberaterin im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch-Technik-Interaktion, Gesundheit.
Die VDI/VDE-IT GmbH berät Politik, entwickelt Förderprogramme, koordiniert Forschungsinitiativen, analysiert Trends und organisiert Geschäftsstellen und Kontaktbüros. Wir helfen, Risiken früh zu erkennen und daraus zukunftsfähige Strukturen zu bauen.
Ob Surveillance im Sinne einer systematischen und kontinuierlichen Überwachung von Krankheiten und Gesundheitsdaten, One Health als zusammenhängende Betrachtung der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt, Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes oder Bildung zu Gesundheitsthemen – wir übersetzen Wissen in Wirkung.